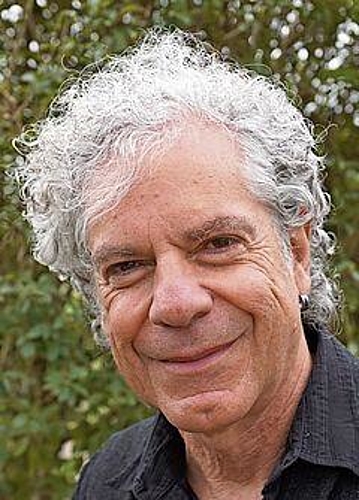«Wir waren die Schwachen, sie die Starken»
Unvergessen Der Theologe und Theatermann Christoph Schwager – er ist Inhaber des Schwager Theaters in Olten – wollte als Bub Missionar werden. Er erfüllte sich seinen Traum teilweise: Mitte der 80er-Jahre wirkte er mit seiner Frau Lisbeth viereinhalb Jahre in einem Armenviertel der peruanischen Hauptstadt Lima.
Christoph Schwager wurde im März 1957 geboren. Er wuchs als jüngstes von vier Kindern in Egerkingen auf. Seine Eltern führten im Dorf einen Coiffeursalon. In jeder freien Minute betrieb Schwager Sport: Leichtathletik, Handball, vor allem aber Fussball. Er war ein talentierter Goalie und gehörte als Teenager dem Kader des damaligen NLB-Klubs FC Grenchen an. Schon als Primarschüler wusste er, dass er dereinst als Missionar wirken wollte. Nach einer zweijährigen Bürolehre begann er mit 18 Jahren ein Studium am Religionspädagogischen Institut in Luzern. Danach wohnte und arbeitete er zwei Jahre als Jugendseelsorger und Religionslehrer in Beckenried und hütete währenddessen als Captain das Tor des Erstligisten SC Buochs, ehe er das Theologiestudium in Chur fortführte. Schwager heiratete bereits mit 20 Jahren, im Jahr 1977. 1981 kam Tochter Sandrine zur Welt. Nach einer intensiven dreimonatigen Vorbereitung trat das Ehepaar Schwager Anfang des Jahres 1983 einen mehrjährigen Auslandseinsatz im Dienst der Missionsgesellschaft Bethlehem Immensee an. Mit der zweijährigen Tochter zog das junge Paar nach Lima, die Hauptstadt Perus.
«Während meines Studiums in Chur hatte es sich im Austausch mit meiner Frau herauskristallisiert, dass wir im Ausland in der Entwicklungshilfe tätig sein wollten. Es war unser gemeinsamer Wunsch. Wir informierten uns, wo und in welchem Rahmen ein solcher Einsatz möglich sein würde. Dann mussten wir Aufnahmeverfahren bestehen und prüfen, für welche Projekte unser berufliches Profil überhaupt in Frage kam. Auch Afrika wäre eine Option gewesen. Aber damals gab es dort für einen Theologen keine Projekte. In Lateinamerika aber schon. Wir verpflichteten uns für drei Jahre in Peru. Eigentlich wären wir am liebsten in die Anden gegangen, in eine ländliche Gegend. Dort hätten wir neben Spanisch aber auch Quechua beherrschen müssen. Für die Dauer von drei Jahren wäre das zu schwierig und zu wenig sinnvoll gewesen. So entschieden wir uns für ein Projekt in einem Armenviertel Limas. In den ersten drei Monaten nach unserer Ankunft lernten wir in einem Intensivsprachkurs Spanisch. Am Morgen meine Frau, am Nachmittag ich. Derjenige Elternteil, der nicht die Schulbank drückte, kümmerte sich um unsere Tochter.
Zu Beginn wohnten wir im Nobelviertel Miraflores, zogen dann aber um ins Armenviertel, in dem wir fortan auch arbeiten würden. In diesem Quartier, das zu unserer Pfarrei «Maria Madre del Pueblo del Dios» gehörte, empfanden wir das Spanisch fast als neue Sprache. Die dortigen Bewohner sprachen viel schneller, verwendeten andere Ausdrücke. Dieses Nicht-Beherrschen der Sprache entpuppte sich nachträglich in der Arbeit mit den Einheimischen jedoch als absoluter Glücksfall. Wir waren die Schwachen, sie die Starken. Sie waren diejenigen, die uns etwas beibringen konnten, sie waren unsere Lehrerinnen und Lehrer. Das öffnete uns viele Türen.
Wir brauchten mindestens sechs Monate Zeit, um zu verstehen, wie diese Leute leben, welche Freuden, Bedürfnisse und Probleme sie haben. Erst dann konnten wir gemeinsam mit ihnen neue Projekte entwickeln. Im Gegensatz zu anderen Entwicklungsorganisationen, die in der Schweiz Projekte entwickeln und sie dann vor Ort einpflanzen, haben wir mit den Leuten verschiedene Projekte kreiert. Ich vor allem in der Jugendseelsorge, meine Frau in der Volksküche. Durch diese Herangehensweise waren es Projekte der dortigen Leute, nicht Projekte von uns. Wir waren einfach die Coaches. In der Kerngruppe, die meine Frau begleitete, bereiteten Mütter täglich gruppenweise Mittagessen vor. Dazu gab es Ausbildungen, etwa Alphabetisierungskurse oder Kurse über die politischen Rechte. In meiner Kerngruppe entwickelte ich Projekte mit anderen Jugendlichen, beispielsweise Jugendwochen oder Weiterbildungsveranstaltungen. Und als Theologe leitete ich Gottesdienste, oftmals unter freiem Himmel, auf der Strasse. Als Altar diente ein Küchentisch.
Wir waren freiwillige Mitarbeiter, wir arbeiteten ohne Lohn. Allerdings bekamen wir einen Lebensunterhalt garantiert, inklusive Wohnraum. Wir hatten in Peru das Privileg, nicht aufs Geld achten zu müssen. Im Vergleich zu unserem vorgängigen Leben in der Schweiz lebten wir jedoch bescheiden. Die Wohnung – innerhalb der Pfarreiräume – bestand aus einer Küche und einem Schlafzimmer. Am Schluss lebten wir da zu fünft. Aber wir hatten nie das Gefühl, arm zu leben. Im Gegenteil: Wir fühlten uns immer privilegiert. Wir hätten ja jederzeit ins Flugzeug steigen und heimfliegen können. Etwa alle drei Monate verschickten wir einen Rundbrief in die Schweiz. Die dadurch generierten Spenden finanzierten unseren Einsatz hauptsächlich.
In der Vorbereitung sagte man uns, dass wir bei diesem Einsatz mehr profitieren als geben würden. Dem war so. Dass sich das aber in einem derart grossen Mass bewahrheiten würde, hätten wir nicht gedacht. Wir wurden viel reicher beschenkt, als dass wir selber hätten schenken können – immateriell natürlich.
In dieser Zeit herrschte Bürgerkrieg in Peru. Die maoistische terroristische Organisation «Sendero Luminoso» und das Militär bekriegten sich, oft mit den gleichen Methoden. Das Volk stand dazwischen. Als Weisse, als Gringos, die im Armenviertel lebten, standen wir unter Beobachtung des Militärs. So kam es manchmal vor, dass wir in Gottesdiensten bespitzelt wurden. Wir lebten und arbeiteten ständig in diesem Spannungsfeld. Weil wir uns für die Menschenrechte der armen Bevölkerung einsetzten, war die Seelsorge auch eine politische Arbeit.
Wir hatten uns lange auf den Einsatz vorbereitet. Die Vorstellung war, dass wir uns immer besser in der dortigen Kultur zurechtfinden würden. Tatsächlich war es aber umgekehrt: Je mehr wir sie kennenlernten, desto weniger verstanden wir diese für uns fremde Kultur. Nicht die Antworten nahmen zu, sondern die Fragen. Das war eine der Hauptschwierigkeiten bei unserem Einsatz. Eine andere war das Leben im Spannungsfeld zwischen der Solidarität mit den einheimischen Menschen und dem Bewusstsein, selbst privilegiert zu sein. Zum Glück haben wir mit möglichst wenig Geld gearbeitet. Wir finanzierten einzig Gemeinschaftswerke, wie zum Beispiel die Volksküche. Wir gaben kein Geld für Einzelfälle aus. Hätten wir damit angefangen, wären wir in einen Teufelskreis hineingeraten. Denn praktisch alle Menschen im Armenviertel hatten irgendwelche wirtschaftlichen Probleme.
Die dritte Schwierigkeit war: Wir bewegten etwas mit unserem Einsatz, unterstützten einen Prozess, der das Leben der Leute verbesserte. Aber gleichwohl handelte es sich nur um ein Sandkorn am Meeresstrand. Für dich selber ist der Einsatz weltbewegend, enorm prägend für dein Leben. Aber für eine ‹bessere Welt› oder nur schon für die Verbesserung der Lebensrealität der Menschen in Peru ist das Resultat deiner Arbeit verschwindend klein. Mit dieser Diskrepanz muss man leben können.
Nach zwei Jahren merkten wir bereits, dass drei Jahre Einsatz zu wenig sein würden. Wir entschlossen uns, den Aufenthalt zu verlängern. Es wäre sogar denkbar gewesen, dass wir uns für einen Verbleib in Peru entschieden hätten. Doch wir entschlossen uns nach einem langen Prozess der Entscheidungsfindung dazu, mit der Solidaritätsarbeit in der Schweiz weiterzumachen. So kehrten wir im Frühjahr 1987 zurück, vor der Einschulung unserer Tochter. Sie sprach nicht mehr Deutsch, verstand uns zwar, unterhielt sich aber bloss auf Spanisch. Als wir in die Schweiz zurückkehrten, waren wir zu fünft. Meine Frau und ich hatten 1986 einen Jungen adoptiert, bald darauf kam ein Sohn zur Welt.
Obwohl der Einstieg in Peru äusserst schwierig gewesen war – ein Kulturschock für uns –, war das Zurückkommen noch schwieriger. Wir dachten, wir würden nach Haus kommen und hier alles kennen. Aber in vier Jahren passiert eine Entwicklung. Und vor allem schauten wir das einst Gewohnte mit anderen Augen an. Die Wertvorstellungen hatten sich verändert durch diese intensive Erfahrung im Armenviertel. Ein konkretes Beispiel: Im Armenviertel in Lima, wo wir wohnten, hatten mehr als 90 Prozent der Leute keinen Zugang zu fliessendem Wasser. In unserer Wohnung befand sich ein kleiner Wassertank mit einer Pumpe – so verfügten wir meistens über Wasser. Doch uns war bewusst geworden, wie wertvoll Wasser ist. In unserer Gesellschaft in der Schweiz gibt es dafür kein Bewusstsein. Wegen Gewissensbissen konnte ich ein Jahr lang kein Bad nehmen in der Badewanne. Natürlich wusste ich, dass mein Verzicht den Leuten im Süden nichts nützen würde. Aber die Erfahrung in Peru hatte mich sehr geprägt.»
Nach der Rückkehr in die Schweiz absolvierte Schwager als Berufseinführung in die theologische Tätigkeit ein Pastoraljahr. Er arbeitete als Seelsorger in Zurzach und studierte an der Uni Luzern. 1988, als seine Frau erneut einen Sohn gebar, übernahm Schwager als Gemeindeleiter die römisch-katholische Kirchgemeinde Härkingen. Er war der erste Nichtpriester in dieser Funktion im Gäu und lebte mit seiner Frau fortan im Pfarrhaus in Härkingen. 1998 gab er diese Funktion auf. Seit 1994 hatte er sich im Schauspielbereich ausbilden lassen. Ab 1998 arbeitete er als Spitalseelsorger in Zofingen und baute parallel sein eigenes Theaterinstitut in Olten auf. Seit 2001 arbeitet er ausschliesslich im Theaterbereich – als Autor, Regisseur, Schauspieler, Pantomime, Kursleiter, Institutsleiter, Seminarleiter. 2006 eröffnete er das Schwager Theater in Olten. Die Leitung des Theaterinstituts will er nun schrittweise in andere Hände legen. 2016 kehrte Schwager mit seiner Frau erstmals wieder nach Lima zurück – 29 Jahre danach. Im Armenviertel, das nun ein anderes Gesicht hat, ging die Meldung über den Besuch des Paars aus der Schweiz um wie ein Lauffeuer. Unzählige Leute, erinnert sich Schwager, hätten sie begrüsst und umarmt. Christoph Schwager gab 1994 das Büchlein «Morgen erst beginnt der neue Tag – Erzählungen aus den Armenvierteln Limas» heraus und schrieb 2016 das Erzähltheater «Dios mio, mehr Gold». In letzterem begegnen sich Francisco Pizarro, der Eroberer des Inkareiches, der Jesuitenpater Samuel Fritz und Christoph Schwager. Mit diesem Stück ist der bald 66-Jährige noch immer unterwegs.